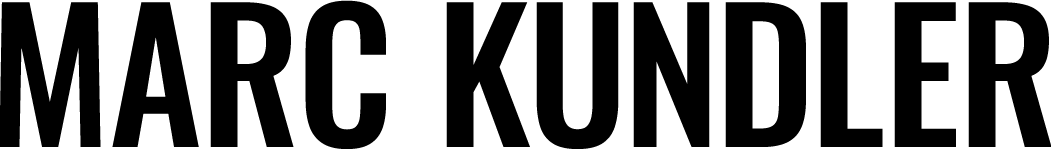Dienstag Nachmittag. Ein Café im Prenzlauer Berg. Neben mir (eigentlich 4 Tische neben mir, doch gefühlt, neben mir) sitzen 3 Typen. Start-Up. Sie beklagen sich über die Hipster-Kultur in Berlin. Ihre Stimmfarbe ist sehr männlich. Die Tonart sehr weiblich. Das St. Oberholz sei der „letzte Hipsterschuppen“. Irgendein anderer Typ soll bitte sofort die „Files“ rüberschicken, damit die „Präsi“ noch bis morgen fertig wird. Zusätzlich imitieren sie noch zugezogene Schwaben, die sich mittlerweile wie die „Pest“ in ihrem Kiez breit gemacht haben.
Kurz darauf schlendert einer der drei, in 11-Tage-Bart, Sonnenbrille mit segeltypischem Befestigungsband und als Rucksack getarnten Sportbeutel zur Kellnerin. Er hätte gerne eine „nicht zu saure“ Rhabarber-Schorle. Wenig später offenbart einer der anderen, dass er am Wochenende mal wieder in die Heimat düst – nach Hannover. Richtig – die alte im Barockstil errichtete Kaiserstadt Hannover, die mit ihren Ecken und Kanten nur so glänzt. Der Typ spricht dabei so omnipräsent, dass ihn nun auch Landwirte in Süd-Potsdam kennen.
Mit dem Gefühl nen dicken, kratzigen Fussel im Ohr zu haben, versinke ich wieder in meinem Laptop und frage mich – verachten wir das am meisten, was wir selbst sind? Gerade hier, im Reinkarnationszentrum der bedingungslosen Selbstliebe? Und falls ja, bin ich auch so?
Während ich noch zwischen „ja“, „nein“ und „ich lasse mir dass lieber mal von Richard David Precht innerhalb von 3 Stunden erklären“ schwanke, sehe ich auf der anderen Seite diese Kabeltrommel umzingelt von 6 Bauarbeitern. (Es gibt übrigens nichts anmutigeres, als eine massive, stabile Kabeltrommel mitten im Hochsommer). Der eine Bauarbeiter schreit in männlicher Stimmfarbe und noch männlicheren Tonart „Jungs, ick broch en Eis“. Darauf sein Kollege, „Bring mir eens mit !“.
„Wat en für eeens ?“ – „Magnum!“. „Welche Sorte du Sackjesicht?“ – „Klääääsick ! „
In meinen Bauch fährt ein warmes, wohliges Gefühl der Zustimmung. Alles ist in Ordnung.